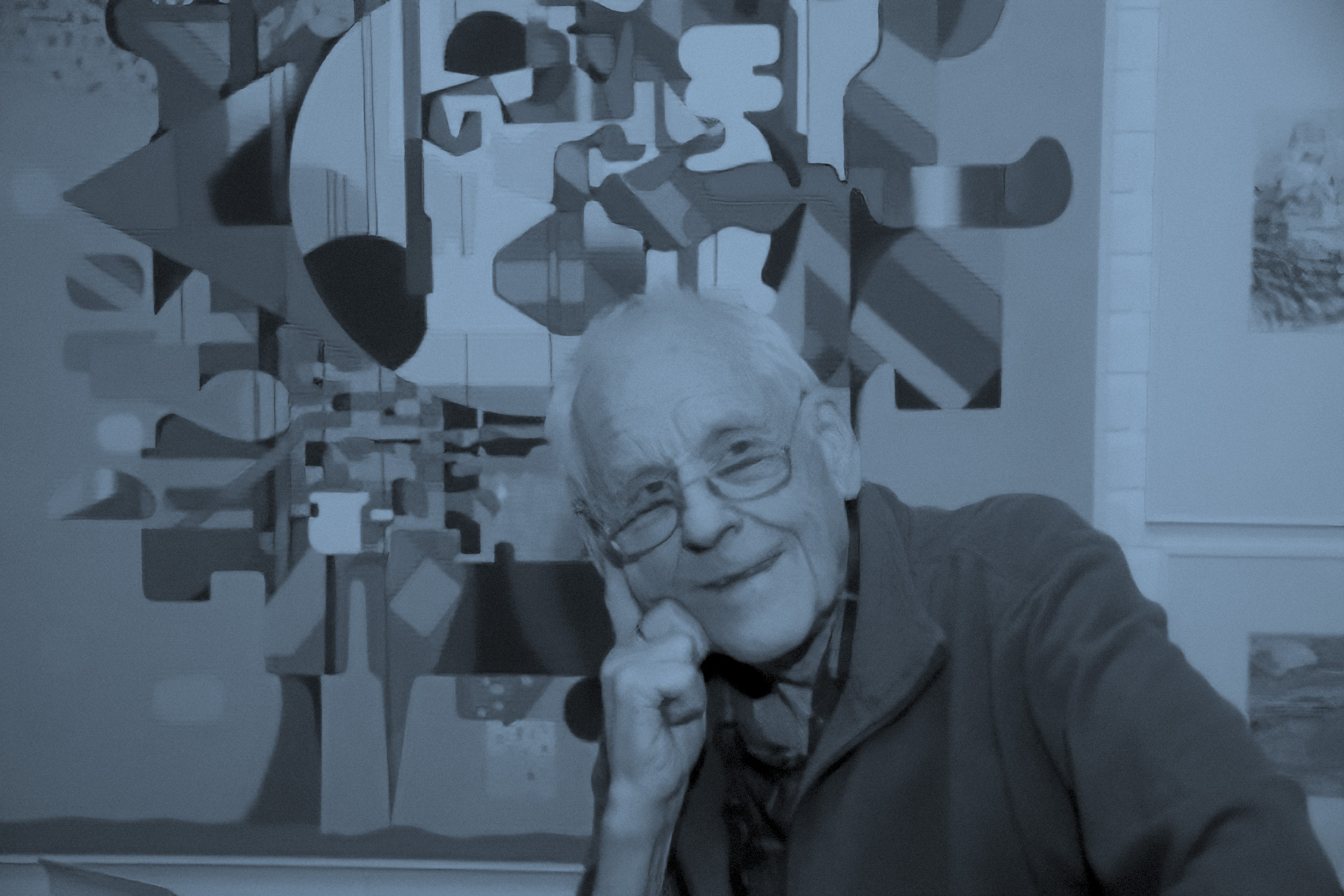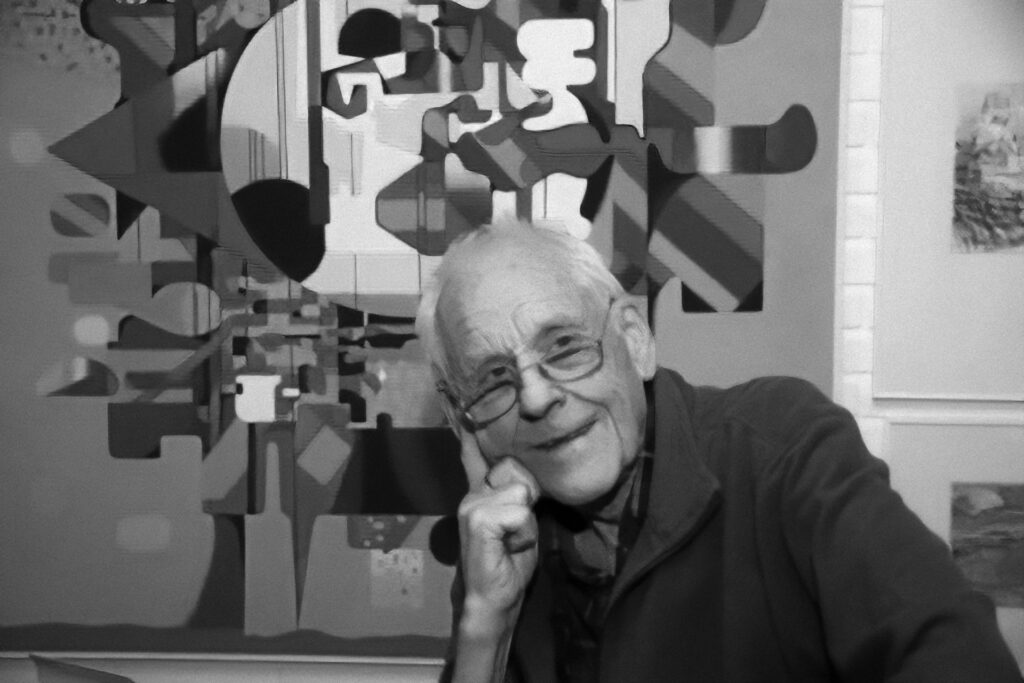Gerhard Uhlig (1924–2015) besuchte Baumeisters Unterricht von 1949 bis 1953. 1953 wurde er Kunsterzieher, 1969 Studiendirektor und Fachbeauftragter für Kunsterziehung in Münster.
Während meines Kunststudiums (Kunsterziehung, Lehramt für Gymnasien) hat es zwei Lehrer gegeben, die meine Auffassung hinsichtlich des künstlerischen Tuns besonders beeinflußt haben: J. Hegenbarth und W. Baumeister. Beide waren Arbeiter, Künstlerallüren waren ihnen zuwider.
Arbeiten bedeutete bei Baumeister die intensive ungeschminkte Auseinandersetzung mit den Gegenständen, durch die Bildinformationen gegeben/vermittelt werden, gebunden an eine geordnete, regelmäßige Arbeitszeit, orientiert an dem Zeitumfang, wie er jedem anderen Berufstätigen auferlegt ist. Baumeister wurde ungehalten, wenn ein Studierender mit der Arbeitszeit lax umging, und er scheute sich nicht, sein Mißfallen der betreffenden Person deutlich zu machen.
Signaturen auf Bildern bzw. Arbeitsblättern seiner Schüler waren unerwünscht. Signaturen galten als Zeichen für etwas Fertiges, Vollkommenes, für etwas, das Korrekturen ausschließt. Signieren darf, so Baumeisters Meinung, wer Lehre nicht mehr nötig hat; er muß wissen, daß die Unterschrift für den Betrachter ein Qualitätsmerkmal ist. Lernende, die signieren, haben keinen zureichenden Einblick in ihren Leistungsstand. Das Üben habe im Vordergrund zu stehen, nicht das fertige Bild. Mit dieser Haltung schärfte Baumeister unsere Selbstkritik und das Verantwortungsgefühl dem Betrachter/Konsumenten gegenüber.
Die Strenge der Arbeitsdisziplin Baumeisters war mit Toleranz und Warmherzigkeit gepaart.
Es durften auch gegenständliche Arbeiten zur Korrektur vorgelegt werden, niemand wurde deshalb zurückgesetzt, im Gegensatz zum Verhalten einiger anderer damals unterrichtender Dozenten, für die Baumeisters Lehre Jugendverführung und seine Schüler ein rotes Tuch waren.
Die Diskrepanz zwischen Baumeister und diesen Dozenten war offensichtlich. Baumeister wurde geschnitten. Ich sah ihn niemals in der Mensa mit ihnen zusammen, auch nicht bei anderen Gelegenheiten. Sofern er seine Mahlzeit in der Mensa einnahm, saß er stets an unserem Tisch. Er teilte sein Essen mit denen, die karg leben mußten. Auch das Butterbrot, das ihm seine Tochter verschiedentlich in die Akademie brachte, aß er nicht allein.
Sonntags, am Vormittag, konnte ihn besuchen, wer sich für seine Bilder interessierte, gleich in welcher Form, ob als möglicher Erwerber oder auch als Nur-Betrachter. Die Besucher kamen aus aller Welt, aus europäischen und außereuropäischen Ländern. Trotz der Großzügigkeit, mit der Baumeister diese Matinees versah, schienen sie mir Pflichtübung. Oft genug erwarteten die Besucher Bildinterpretationen, die ihre Erwartungshaltung treffen sollten; dafür hatte Baumeister nichts übrig. Bei diesen Matinees überließ er mir verhältnismäßig häufig die künstlerische Betreuung der Besucher. Für mich war das eine Auszeichnung.
Baumeisters Lehre hat mich in meinem Berufsleben begleitet, nicht im reproduktiven Sinne, sondern weiterführend. Sie hat auf meine eigene bildgestalterische Arbeit gewirkt, vor allen Dingen und zunächst auf meinen didaktischen Auftrag als Kunstlehrer am Gymnasium, dann als Fachbeauftragter des Schulkollegiums Münster mit einem Tätigkeitsbereich, der sich über ganz Westfalen erstreckte, und als Leiter der Fortbildungsveranstaltungen (für Kunstlehrer an Gymnasien) dieser Behörde.
Wollte ich Maximen aufstellen, die aus der Baumeisterschen Lehre erwachsen sind, so würde ich folgende Akzente nennen:
- Kunstlehre verlangt Sachlichkeit. Sie hat darum bemüht zu sein, die Übertragung vom künstlerischen Objekt zum Betrachter/Interpretanten so störungsfrei wie möglich zu machen.
- Erst dann können sich Empfindung (ich verstehe unter Empfindung die Aufnahme und Weiterleitung eines Sinnenreizes bis zum Zentralorgan, erst dort setzen Wahrnehmung und Reflexion ein), Wahrnehmung und Reflexion zu einer sinnvollen Einheit verbinden und zweckmäßiges Handeln auslösen.
- Empfindung setzt Reflexion voraus; Reflexion ist ohne Empfindung nicht möglich.
- Das Training des Empfindens ist unerläßliche Bedingung und dem Training der Reflexion gleichzusetzen.
- Wo das Empfindungstraining vernachlässigt wird, müssen zwangsläufig mehr theoretisch erworbene Empfindungsdaten reflektiert werden. Daraus resultiert eine Stagnation der Kreativität; Kreativität bedingt neue Empfindungs- und Wahrnehmungsformen.
- Kunst bietet aufgrund ihres weiten, zweckfreien Freiheitsfeldes viele neue Empfindungs- und Wahrnehmungsformen. Sie fördert die Sensibilität bestimmter Empfindungsbereiche und erweitert die Aufnahme- und Verarbeitungsfähigkeit des Menschen. Dabei ist die ästhetische Komponente in Gestaltungswerken der Vermittler, damit überhaupt wahrgenommen wird/werden kann. Wo sie banalisiert oder zurückgedrängt wird, sind Manipulationen Tür und Tor geöffnet.
- Die ästhetische Komponente hat einen hohen sozialpolitischen und erzieherischen Stellenwert.
Für den Kunstlehrer sind nicht die Bilder das Lehrziel, sondern die Erweiterung der Fähigkeiten des Lernenden, damit er sich in seiner Umwelt angemessen verhalten kann, also auch Bild/Gestaltungssituationen gegenüber. Das entstandene Bild, auch geistige Bild, ist dem Lehrenden Lehrkontrolle. Die Übung gewinnt dabei Vorrang, weil sie besser als ein fertiges Bild auch dem Schüler zeigt, inwieweit er einen Lernerfolg erreicht hat.
(aus einem Brief an Wolfgang Kermer vom 22. April 1986, zitiert nach Kermer 1992, S. 182 f. )